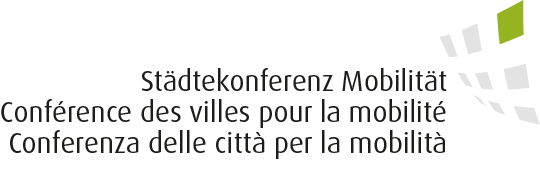Tempo 30 auf Hauptachsen: ein Faktencheck
Tempo 30 auf Hauptachsen innerorts wird in der Politik und in den Medien oft kontrovers diskutiert. Für die Städte ist Tempo 30 auf Hauptachsen eine sinnvolle Massnahme, um die Strassen für alle Menschen sicherer zu machen, den Verkehrslärm an der Quelle zu bekämpfen und den öffentlichen Raum aufzuwerten. Da sie einem wachsenden Bedürfnis der städtischen Bevölkerung entspricht (GFS Bern, 2024), fordern die Städte, Tempo 30 rasch, einfach und situativ angepasst einführen zu können, wo es aus Gründen der Sicherheit, des Lärmschutzes oder der Lebensqualität Sinn ergibt.
Die Städtekonferenz Mobilität SKM hat einen Faktencheck zu Tempo 30 auf Hauptachsen im Videoformat erstellt.
Die Städtekonferenz Mobilität SKM hat einen Faktencheck zu Tempo 30 auf Hauptachsen im Videoformat erstellt.
Tempo-30-Strecken versus Tempo-30-Zonen
Tempo-30-Zonen kommen primär auf dem untergeordneten Strassennetz, meist im Quartier, zum Zug und heben die Hierarchie zwischen den Strassen auf. Es gilt Rechtsvortritt, Fussgängerstreifen sind nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Tempo-30-Zonen werden in der Regel so gestaltet, dass sie für den Durchgangsverkehr unattraktiv sind. Auf Hauptachsen kommen meist Tempo-30-Strecken zum Zug; so wird ihr übergeordneter Charakter beibehalten. Eine Tempo-30-Strecke bleibt gegenüber sekundären Strassen vortrittsberechtigt, sie ermöglicht Fussgängerstreifen und muss nicht anders gestaltet werden als eine Tempo-50-Strecke.
Zeitverlust
Bei einer Reduktion von 50 km/h auf 30 km/h nimmt die theoretische Reisezeit um 5 s/100 m zu (Haefliger et al. 2019). In der Praxis sind es jedoch rund 2 Sekunden pro 100 Meter, da zu den Hauptverkehrszeiten meist sowieso nicht 50km/h gefahren werden kann. Wenn die Tempo-30-Abschnitte verhältnismässig kurz sind, ist der absolute Zeitverlust für Autofahrende praktisch nicht spürbar. Bei Stau und dichtem Verkehr kann mit Tempo 30 ein besserer Verkehrsfluss erreicht werden, denn die Fahrzeuge können ein gleichmässigeres Tempo fahren (Kanton Luzern, 2024, Faktenblatt 7). In diesen Situationen führt Tempo 30 also zu einem Zeitgewinn.
Verkehrssicherheit
Gemäss Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU kann mit der Umwandlung von Tempo-50 in Tempo-30-Strecken ein Drittel aller schweren Unfälle vermieden werden (BFU, 2020). Bezogen auf die Unfallzahlen von 2024 (BFU, 2025) kann Tempo 30 somit rund 760 Schwerverletzte und 40 Getötete pro Jahr vermeiden. Der Anhalteweg halbiert sich mit Tempo 30 gegenüber Tempo 50. Wo ein Auto mit einer Anfangsgeschwindigkeit von Tempo 30 bei einer Vollbremsung zum Stillstand kommt, befindet sich eine Person im Auto mit Tempo 50 noch in der Reaktionsphase und ist noch nicht mal auf die Bremse getreten (BFU, 2020). Tempo 30 führt damit zu einem enormem Sicherheitsgewinn und senkt das Risiko für Menschen gerade auf Fussgängerstreifen und auf Schulwegen.
Ausweichverkehr
Aus der Forschung gibt es keine Hinweise, dass Tempo 30 auf Hauptachsen Ausweichverkehr verursacht. Ein Forschungsbericht des ASTRA (Haefliger et al., 2019) hält fest, dass «kein dokumentierter Fall bekannt ist, bei welchem aufgrund einer Reduktion auf Tempo 30 auf einer Hauptverkehrsstrasse unerwünschter Ausweichverkehr in die Quartiere aufgetreten ist». Zum gleichen Schluss kommt ein kürzlich erstelltes Faktenblatt des Kantons Luzern (Kanton Luzern, 2024): «Bei den bisher umgesetzten Tempo-30-Strecken in Ortskernen kam es nicht zu Schleichverkehr».
Lärmschutz
Städte, Gemeinden und Kantone sind als Strasseneigentümerinnen gesetzlich dazu verpflichtet, die ansässige Bevölkerung vor Lärm zu schützen. Als wirksamste Methoden haben sich sowohl Geschwindigkeitsreduktionen als auch lärmarme Beläge etabliert. Eine Reduktion auf Tempo 30 kann die durchschnittliche Lärmemission um rund 3 db(A) reduzieren. Das wirkt akustisch wie eine Halbierung der Verkehrsmenge (BAFU, 2025). Auf den meisten städtischen Hauptachsen braucht es eine Kombination von Tempo 30 und lärmarmen Belägen, um die Grenzwerte einzuhalten. Die Elektromobilität bietet ein zusätzlichen Reduktionspotenzial, jedoch nur bei langsamen Geschwindigkeiten, weil ab 25km/h nicht mehr die Motoren- sondern die Reifengeräusche dominieren.
Hierarchie des Strassennetztes
Die Hierarchie der Strassen ergibt sich aus ihrer unterschiedlichen Leistungsfähigkeit. In seinem Planungsbericht zu Tempo 30 kommt der Kanton Luzern zum Schluss, dass sich die Leistungsfähigkeit einer verkehrsorientierten Strasse innerorts mit Tempo 30 kaum ändert (Kanton Luzern, 2024). Die Leistungsfähigkeit einer Strasse werde primär durch die Art und die Anzahl der Knotenpunkte (Lichtsignale, Kreisel, Kreuzungen) bestimmt. Auch das ASTRA (2025) hält im Bericht zur Umsetzung der Motion 21.4516 Schilliger fest: «Damit die Strassenhierarchie gewahrt bleibt (..) ist die betriebliche und die baulich-gestalterische Einrichtung der Strassen zentral». Wenn dieser Grundsatz eingehalten sei, könne die Verkehrsabwicklung auf dem übergeordneten Netz sogar dann deutlich effizienter erfolgen, wenn die Geschwindigkeit nicht höher sei als auf dem untergeordneten Netz. Mit anderen Worten: Mit Tempo 30 wird die Leistungsfähigkeit von Hauptachsen und damit die Netzhierarchie gewährleistet.
Reisezeiten öffentlicher Verkehr
Bei den durch das ASTRA (2019) untersuchten Beispielen wurden «keine massgeblichen Änderungen der Reisezeit für MIV oder öV festgestellt». Der Kanton Luzern (2024) hat die Wirkung von Tempo 30 in Ortskernen auf die Gesamtreisezeiten von vier Buslinien untersuchen lassen. Tempo 30 verlängerte die Gesamtreisezeiten um bis zu 35 Sekunden. Diese Verzögerungen lassen sich mit Buspriorisierungen und weiteren betrieblichen Optimierungen kompensieren. Zu einem ähnlichen Resultat kommt der Monitoringbericht der Stadt Freiburg (Ville de Fribourg, 2025) zur Tempo-30-Einführung auf städtischen Hauptachsen. In der Stadt Aarau konnten bei der Einführung von Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse durch die Aufhebung von Lichtsignalanlagen und neue Fahrbahnhaltestellen die Reiszeiten um 77 Sekunden gesenkt und damit eine bessere Fahrplanstabilität erzielt werden (Viaplan AG, 2025).
Lebensqualität und Aufwertung des Stadtraums
Tempo 30 auf Hauptachsen verbessert die Lebens- und Aufenthaltsqualität: Weniger Trennwirkung durch Strassen, neue Flächen für Grünräume durch schmalere Fahrbahnen, attraktivere Strassengestaltung (Kanton Luzern, 2024). Von angenehmeren Strassenräumen profitiert auch das lokale Gewerbe und die Attraktivität der angrenzenden Liegenschaften. Zudem bringt die langsamere und menschengerechtere Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs mehr Sicherheit und Platz für Menschen auf dem Velo und zu Fuss.
Polizei, Feuerwehr und Sanität auf Tempo-30-Strecken
Nicht die Tempobeschränkung, sondern die Verkehrsdichte ist primär entscheidend, wie schnell ein Feuerwehrauto oder ein Krankenwagen vorwärtskommt. Frühere Schwachstellen bei den gesetzlichen Bestimmungen zu Geschwindigkeitsübertretungen für Blaulichtorganisationen wurden im Zuge der letzten Teilrevision des Strassenverkehrsgesetztes SVG beseitigt. Gestützt auf Art. 100 SVG dürfen Blaulichtorganisationen als vortrittsberechtige Fahrzeuge von den geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen abweichen (ASTRA 2021). Voraussetzung ist, dass sie alle Sorgfalt walten lassen und die erforderlichen Warnsignale abgeben. Zudem gilt: Wer in Notfällen von den Verkehrsregeln abweicht und damit «höherwertige Interessen wahrt», kann auf einen rechtfertigenden Notstand gemäss Art. 17 Strafgesetzbuch StGB verweisen werden.
Medienmitteilung - Mit Tempo 30 zu mehr Lebensqualität
16.05.2023 - Weniger Lärm, mehr Sicherheit, mehr Platz, bessere Koexistenz zwischen den verschiedenen Fortbewegungsarten – dies sind nur einige der Vorteile von Tempo 30. Dies zeigt ein Positionspapier der Städtekonferenz Mobilität (SKM). Insbesondere der Strassenlärm blockiert die Stadtentwicklung, auch da Lärmschutzvorschriften zahlreiche Bau- und Sanierungsprojekte blockieren. Der Lärm muss an der Quelle reduziert werden. Tempo 30 ist die einfachste und kostengünstigste Lösung.